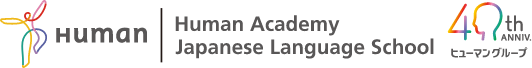Sake passt hervorragend zu japanischem Essen und kann warm oder kalt genossen werden. In den letzten Jahren hat sich die Vielfalt an Sake-Sorten deutlich erhöht, darunter auch solche, die speziell für jüngere Generationen, Frauen und ein internationales Publikum entwickelt wurden.
Dieser Artikel erklärt die Grundlagen, Sorten und Geschmacksrichtungen von Sake, einem weltweit beliebten alkoholischen Getränk. Nutzen Sie ihn als Informationsquelle zur japanischen Küche bei kulturellen Begegnungen oder als Nachschlagewerk bei der Auswahl Ihres Lieblings-Sake.
Grundkenntnisse über Sake

Schauen wir uns zunächst die Definition von Sake und die Aufgabe des „Toji“ (Braumeisters) an, der Sake herstellt.
◇ [Definition von Sake] Was ist eigentlich ein Getränk, das man „Sake“ nennt?
Sake wird definiert als ein Getränk aus weißem Reis, das mit Koji und Wasser fermentiert und gereift wird und Alkohol enthält. Die Herstellung von Sake erfolgt durch Zugabe von Koji und Wasser zu gedämpftem weißen Reis und anschließendes Fermentieren.
Nach dem Alkoholsteuergesetz wird Sake als „Seishu“ eingestuft, was als Sake aus Reis definiert ist, der während der Produktion einen Filterprozess durchlaufen muss.
Sake wird im Allgemeinen einfach als Osake bezeichnet, in der Antike hieß er Sasa, und in englischsprachigen Ländern wird er manchmal als „japanischer Reiswein“ bezeichnet, aber heutzutage setzt sich die Bezeichnung „Sake“ immer mehr durch.
◇Was ist ein „Toji“, der Sake herstellt?
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Sake-Wissens ist die Person, die man „Toji“ (Braumeister) nennt. Ein Braumeister ist für die Überwachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Sake-Herstellung in einer Brauerei verantwortlich. Die anderen an der Sake-Herstellung beteiligten Techniker werden übrigens „Kurabito“ (Brauereiarbeiter) genannt.
Die Braumeister sind nicht nur für die Überwachung der Brauer verantwortlich, sondern auch für die Steuerung aller komplexen Prozesse der Sake-Herstellung. Sie sind zudem Experten mit dem nötigen chemischen Wissen, um den Gärungsprozess der Maische zu verstehen. Echigo in Niigata, Nanbu in Iwate und Tamba in Hyogo gelten als die „Drei Großen Braumeister Japans“.
Hauptarten und Merkmale von Sake

Im nächsten Schritt erklären wir die wichtigsten Arten und Eigenschaften von Sake.
◇Spezifischer Namensgeber und seine Klassifizierung
Unter den in Japan verkauften Sake-Sorten können diejenigen, die die Anforderungen des japanischen Alkoholsteuergesetzes erfüllen, als „Ginjo Sake“ oder „Junmai Sake“ bezeichnet werden. Sake mit solchen Bezeichnungen wird als „Sake mit spezifiziertem Namen“ bezeichnet und wie folgt klassifiziert:
◇Ginjo Sake
„Ginjo Sake“ ist eine Bezeichnung, die nur Sake erhalten darf, der ein gutes Aroma und einen guten Geschmack hat, mit einem Poliergrad des Reises von 60 % oder weniger hergestellt wird, nach der sogenannten „Ginjo-Braumethode“ hergestellt wird, die eine langsame Gärung bei niedrigen Temperaturen beinhaltet, und aus Reis, Reis-Koji, Wasser und Braualkohol hergestellt wird.
Der Reispoliergrad gibt an, in welchem Maße der Reis poliert wurde; für Ginjo-Sake mit einem Reispoliergrad von 60 % oder weniger muss der Reis zu mindestens 40 % poliert sein, und für Daiginjo-Sake mit einem Reispoliergrad von 50 % oder weniger muss der Reis zu mindestens 50 % poliert sein.
◇Junmai-Sake
„Junmai-Sake“ ist die Bezeichnung für Sake, der ausschließlich aus Reis, Reis-Koji und Wasser hergestellt wird, also keinen Braualkohol enthält. Junmai-Sake, der nach der Ginjo-Methode gebraut wird, heißt „Junmai Ginjo-Sake“ oder „Junmai Daiginjo-Sake“. Junmai-Sake, der mit anderen Brauverfahren als der Ginjo-Methode hergestellt wird, nennt man „Tokubetsu Junmai-Sake“.
◇Honjozo-Sake
Diese Bezeichnung wird für Sake verwendet, dessen Reiskornanteil 70 % oder weniger beträgt. Er wird aus Reis, Reiskoji, Wasser, Braualkohol usw. hergestellt und zeichnet sich durch einen guten Geschmack und ein feines Aroma aus. Sake mit einem Reiskornanteil von 60 % oder weniger, der nach einem speziellen Brauverfahren hergestellt wird, kann als „spezieller Honjozo-Sake“ bezeichnet werden.
Im Allgemeinen zeichnet sich Ginjo-Sake durch einen lebendigen und fruchtigen Geschmack aus, Junmai-Sake durch einen kräftigen Reisgeschmack mit einer milden Fülle, und Honjozo-Sake hat tendenziell einen einfachen und erfrischenden Geschmack.
Sake wird anhand seines Aromas und Geschmacks in vier Typen eingeteilt.

Zum Schluss erklären wir die vier Sake-Sorten, die nach ihrem Aroma und Geschmack unterteilt werden.
◇Vier verschiedene Sake-Aromen
Die vier Sake-Sorten sind folgende:
Kunshu: Diese Sake-Sorte zeichnet sich durch ein blumiges Aroma und einen fruchtigen, an Früchte erinnernden Geschmack aus. Sake, der nach der Ginjo-Methode hergestellt wird, gilt als Kunshu und hat sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Sake-Sorte entwickelt. Er wird empfohlen, ihn gut gekühlt, ähnlich wie Wein, zu genießen.
Zu den repräsentativen duftenden Sakes gehören „Dassai Junmai Daiginjo 39 % poliert“ und „Ho-o-Bita Junmai Daiginjo Yamadanishiki 50 % poliert“.
Jukushu: Diese Sake-Sorte reift lange und zeichnet sich durch ihren weichen, milden Geschmack und ihr würziges Aroma aus. Gereifter Sake zählt zu dieser Kategorie. Er kann bei Zimmertemperatur, in kleinen Schlucken, erwärmt oder leicht gekühlt genossen werden – so finden Sie ganz nach Ihrem Geschmack die perfekte Temperatur.
Zu den repräsentativen gereiften Sake-Sorten gehören „Kisan Sanban Koshu 1998“ und „Shoryu Horai Jungin Awa Yamada Nishiki 55, direkt abgefüllt in der Brauerei“.
Soushu: Diese Sake-Sorte hat einen erfrischenden Geschmack, der manchmal auch als „trocken“ bezeichnet wird. Honjozo-Sake gehört tendenziell in diese Kategorie. Es wird empfohlen, ihn gut gekühlt im Glas zu trinken.
Zu den repräsentativen erfrischenden Sakes gehören „Hakkaisan Honjozo“, „Kubota Hekiju“ und „Goshun Ginjoshu“.
Junshu: Dieser Sake ermöglicht es Ihnen, den natürlichen Umami-Geschmack und die Süße des Reises zu genießen. Sie können seinen vollen Geschmack bei Zimmertemperatur genießen oder ihn erwärmen, um sein mildes Aroma und seine Süße zu entfalten.
Zu den repräsentativen Junshu-Sakes gehören „Kamigame Junmaishu“ und „Harushika Junmaishu“.
Diese Klassifizierungen sollen Ihnen helfen, den Geschmack der verschiedenen Sake-Sorten und die richtige Trinkweise zu verstehen. Mithilfe dieser Klassifizierungen finden selbst Sake-Skeptiker möglicherweise eine Sorte, die ihnen zusagt.
Zusammenfassung

Sake ist ein alkoholisches Getränk, das durch die Zugabe von Wasser zu Reis und Reis-Koji und anschließende Fermentation hergestellt wird. Je nachdem, ob Braualkohol enthalten ist oder nicht und wie der Reis poliert wurde, wird er als Sake mit einem bestimmten Namen klassifiziert, wie zum Beispiel „Daiginjo“, „Junmaishu“ oder „Honjozoshu“. Sake wird außerdem anhand von Geschmack und Aroma in vier Typen unterteilt: „Kunshu“, „Jukushu“, „Soushu“ und „Junshu“. Jeder Typ hat seine eigene Trinktemperatur und wird traditionell auf seine Weise genossen.
Wir stellen Ihnen außerdem repräsentative Sake-Sorten vor, sodass Sie sicher sein können, den Sake zu finden, der Ihrem Geschmack entspricht.
Dieser Artikel wurde von KARUTA teilweise aus einem ursprünglich auf „Nihongo Biyori“ veröffentlichten Artikel neu bearbeitet.
Jede unbefugte Vervielfältigung oder Verwendung der Inhalte, Texte, Bilder, Illustrationen usw. dieser Website ist strengstens untersagt.