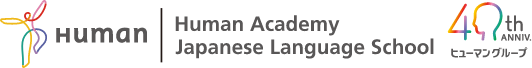In Japan, wo sich die Natur mit den Jahreszeiten wandelt, ist die Kirschblütenbetrachtung ein beliebtes Ereignis, das besonders als Zeichen des Frühlingsbeginns geschätzt wird. In den letzten Jahren ist die Zahl der ausländischen Touristen, die Japan zur Kirschblütenzeit besuchen, stetig gestiegen. Selbst unter denen, die die Kirschblüte jedes Jahr genießen, können wohl nur wenige die Ursprünge dieses Brauchs erklären.
Dieser Artikel erklärt die Ursprünge der Kirschblütenbetrachtung in Japan und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert hat. Das Verständnis der Ursprünge dieser Tradition im Kontext der japanischen Geschichte wird Ihnen helfen, den Zauber der Kirschblütenbetrachtung noch intensiver zu erleben.
Wann begann die Kirschblütenbetrachtung in Japan? Erfahren Sie mehr über ihre Ursprünge.

Wann und wie begann die Kirschblütenbetrachtung in Japan? Wir erklären ihre Ursprünge und Geschichte.
◇Hat die Kirschblütenbetrachtung ihren Ursprung in der Nara-Zeit?
Über den Ursprung des Kirschblütenfestes gibt es verschiedene Theorien, aber wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, scheint es, dass Aristokraten eine Vorliebe für Pflaumenblüten hatten und es genossen, die Blumen während der Nara-Zeit zu bewundern.
Heutzutage meinen wir mit „Blütenbetrachtung“ Kirschblüten, doch damals standen die aus China eingeführten Pflaumenblüten im Mittelpunkt. Das lag nicht daran, dass Kirschblüten unbeliebt waren, sondern daran, dass sie von den Japanern zu jener Zeit als heilige Bäume verehrt wurden.
Tatsächlich gibt es im Manyoshu Gedichte über Kirschblüten, und Kirschblüten werden seit der Zeit vor der antiken Mythologie als von Göttern bewohnte Bäume verehrt.
◇ Die Menschen begannen nach der Heian-Zeit, Kirschblüten zu sehen.
Mit Beginn der Heian-Zeit begannen Aristokraten allmählich, die Kirschblüte als Symbol des Frühlings zu schätzen. Ein Grund dafür dürfte die Abschaffung der japanischen Missionen im China der Tang-Dynastie im Jahr 894 gewesen sein. Dies mag dazu geführt haben, dass sich die Japaner der einheimischen Kirschblüte näher fühlten als der aus China eingeführten Pflaumenblüte.
Auch im Meisterwerk der mittleren Heian-Zeit, der Geschichte vom Prinzen Genji, sind Szenen von Banketten unter den Kirschblüten am Kaiserhof festgehalten, und das Kokin Wakashu, das in der frühen Heian-Zeit zusammengestellt wurde, enthält auch viele Frühlingsgedichte, die von Kirschblüten singen.
Dies lässt darauf schließen, dass die Kirschblüte von den Aristokraten jener Zeit als Symbol des Frühlings angesehen wurde.
◇Nicht nur Adlige, sondern auch Bauern erfreuten sich an der Kirschblüte.
Während Adlige die Kirschblütenfeste besuchten, um die Kirschblüte zu genießen, nahmen auch Bauern aus anderen Gründen teil.
Für Bauern markiert der Frühlingsbeginn den Start der Feldarbeit. Wenn die Frühlingsblumen blühen, werden sie auch aufgrund ihrer religiösen Bedeutung als Schutz vor bösen Geistern verehrt. An festgelegten Terminen finden Feste zur Blumenbetrachtung statt. An diesen Tagen ziehen die Menschen auf die Felder oder in die Berge, um die Blütenpracht zu bewundern und „auf den Feldern“ oder „in den Bergen zu spielen“. Darunter befinden sich auch Kirschbäume. Indem sie sich unter ihnen vergnügten, verbrachten die Menschen möglicherweise Zeit mit den Göttern und beteten um eine reiche Ernte.
Man sagt, dass die Kirschblütenbetrachtung, wie wir sie heute kennen, nach der Edo-Zeit bei der einfachen Bevölkerung als reines Vergnügen populär wurde.
Die Entwicklung der Kirschblütenbetrachtung bis heute

Als nächstes wollen wir uns die Veränderungen in der Kirschblütenbetrachtung von der Kamakura-Zeit bis heute ansehen.
◇ Kirschblütenbetrachtung von der Kamakura-Zeit bis zur Azuchi-Momoyama-Zeit
Bis zur Heian-Zeit war die Kirschblütenbetrachtung ein Vergnügen des Adels, doch während der Kamakura-Zeit verbreitete sie sich allmählich in allen Gesellschaftsschichten. Samurai und Stadtbewohner gleichermaßen erfreuten sich an der Kirschblüte, und man sagt, dass etwa zu dieser Zeit Kirschbäume in den Bergen, Tempeln und Schreinen Kyotos gepflanzt wurden.
Während der Azuchi-Momoyama-Zeit begannen Samurai, die Kirschblüte zu bewundern. Besonders berühmt waren die von Toyotomi Hideyoshi veranstalteten Kirschblütenfeste in Daigo und Yoshino, an denen etwa 5.000 bzw. über 1.000 Besucher teilnahmen. Es handelte sich um prunkvolle Bankette, an denen berühmte Generäle der damaligen Zeit, darunter Tokugawa Ieyasu und Maeda Toshiie, teilnahmen.
◇Kirschblütenbetrachtung in der Edo-Zeit
Ab der Edo-Zeit wurde die Kirschblütenbetrachtung zu einem beliebten Zeitvertreib für die Bevölkerung. In der späteren Edo-Zeit entstand die „Yoshino-Kirsche“, eine verbesserte Version der Oshima-Kirsche und der Edo-Higan-Kirsche. Der Legende nach wurde diese Yoshino-Kirsche von einem Gärtner im Dorf Somei, das im heutigen Tokioter Stadtbezirk Toshima liegt, gezüchtet. Um sie von der Yoshino-Bergkirsche in der Präfektur Nara zu unterscheiden, wurde sie später „Somei Yoshino“ genannt. Dies gilt als Ursprung der heutigen Somei-Yoshino-Kirsche.
Diese Züchtung und Verbesserung von Kirschbäumen verbreitete sich bis zum Ende der Edo-Zeit, und es scheint, dass es zu dieser Zeit etwa 250 bis 300 verschiedene Kirschbaumsorten gab.
◇Kirschblütenbetrachtung seit der Meiji-Zeit
Nach der Meiji-Zeit wurden infolge des Chinesisch-Japanischen und des Russisch-Japanischen Krieges die Samurai-Residenzen und Gärten des Adels nacheinander zerstört. Auch die in den Residenzen und Gärten gepflanzten Kirschbäume wurden verbrannt, und die zahlreichen Kirschbaumsorten, die während der Edo-Zeit kultiviert worden waren, gingen vorübergehend stark zurück.
Ein Gärtner namens Magoemon Takagi, der sich über diese Situation Sorgen machte, sammelte die verbliebenen Kirschbäume ein und pflanzte sie in seinem Garten neu. Man sagt, er habe über 80 verschiedene Kirschbaumsorten gepflanzt.
Auf Geheiß von Magoemon, einem Gärtner aus Komagome, wurde 1886 eine Reihe von Kirschbäumen entlang des Arakawa-Flusses angelegt. Um 1910 hatte sich die Kirschbaumreihe entlang des Arakawa-Flusses bei der Bevölkerung als neuer beliebter Ort zur Kirschblütenbetrachtung etabliert.
Die Kirschbäume, die dank der Bemühungen dieser Gärtner überlebt haben, haben sich seither im ganzen Land verbreitet, und verschiedene Forschungseinrichtungen haben die Sorten immer weiter verbessert, was bis heute geführt hat.
◇ Die Kirschblüte hat sich im ganzen Land verbreitet, und die Kirschblütenzeiten variieren.
Die Kirschblüte, die man einst in Kyoto und der Hauptstadt Edo bewunderte, hat sich im ganzen Land verbreitet, und heute variiert die Blütezeit je nach Region leicht. Die ungefähren Blütezeiten für die einzelnen Regionen sind wie folgt:
Hokkaido: Ende April
Region Tohoku: Ungefähr Anfang April
Andere Gebiete: Etwa Ende März (nur Okinawa: Die Blumen blühen etwa Anfang Februar)
Es ist wunderschön, die heimischen Kirschblüten bei einem Hanami-Fest zu bewundern, aber der Frühling ist auch eine beliebte Jahreszeit für Ausflüge. Wir empfehlen Ihnen außerdem, Kirschblütenorte in verschiedenen Regionen zu besuchen und Hanami an Ihren Reisezielen zu genießen. Wenn Sie beim Betrachten der Kirschblüte die Geschichte der Kirschblüten und des Hanami kennenlernen, fühlen Sie sich vielleicht wie in das alte Japan zurückversetzt.
Zusammenfassung

Hanami, das heute im ganzen Land genossen wird, hat seine Wurzeln in der Zeit vor der Nara-Periode. Damals bewunderte man nicht nur Kirschblüten, sondern auch Pflaumenblüten und andere Frühlingsblumen. Hanami diente dem Adel als Zeitvertreib und den Bauern als religiöses Fest, um für eine gute Ernte zu beten. Viele Kirschbäume wurden während der Edo-Zeit veredelt. Nach der Meiji-Zeit, als die Bäume die Kriegswirren überstanden hatten, verbreiteten sich dank des Engagements von Gärtnern und Forschern Kirschbaumreihen im ganzen Land. Heute kann man die Kirschblüte von Hokkaido bis Okinawa bewundern.
Die Kirschblütenbetrachtung, die sich von der Hauptstadt auf ganz Japan ausgebreitet hat, ist weltweit bekannt geworden, und die Zahl der Besucher aus dem Ausland, die die Kirschblüte bewundern möchten, steigt jährlich. Es wäre wünschenswert, wenn Ausländer nicht nur die Schönheit der Kirschblüte kennenlernen, sondern auch die Gefühle der Japaner für die Kirschblüte und die Geschichte der Kirschblütenbetrachtung verstehen könnten.
Dieser Artikel wurde von KARUTA teilweise aus einem ursprünglich auf „Nihongo Biyori“ veröffentlichten Artikel neu bearbeitet.
Jede unbefugte Vervielfältigung oder Verwendung der Inhalte, Texte, Bilder, Illustrationen usw. dieser Website ist strengstens untersagt.